
|

Das Ausstechzylinderverfahren ist für feinkörnige Böden (Tone und Schluffe) ohne nennenswerten (Grobkornanteile) und für (Fein- bis Mittel-)Sande geeignet. Besonders geeignet ist es für bindige Böden steifer Konsistenz und mitteldicht gelagerte Feinsande. |
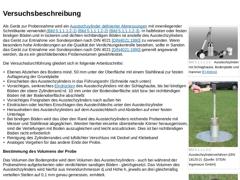
|

| (Bild: Ausstechzylinder mit Schlaghaube, Bodenplatte und Hammer [FI-Röhre]) | | (Bild: Ausstechzylinderverfahren) | | (Bild: Aussstechzylinder) |
Als Gerät zur Probennahme wird ein (Ausstechzylinder nach DIN 18125 Teil 2) mit innenliegender Schnittkante verwendet (Bild 4.1.1.1.2) (Bild 4.1.1.1.2) (Bild 4.1.1.1.2). In halbfesten oder festen bindigen Böden und in lockeren und dichten nichtbindigen Böden ist anstelle des Ausstechzylinders das Gerät zur Entnahme … |
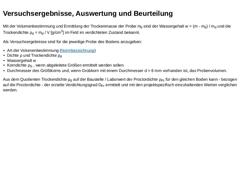
|

Mit der Volumenbestimmung und Ermittlung der Trockenmasse der Probe md sind der Wassergehalt w = (m - md) / md und die Trockendichte ρd = md / V [g/cm3] im Feld im verdichteten Zustand bekannt.
Als Versuchsergebnisse sind für die jeweilige Probe des Bodens anzugeben: - Art der Volumenbestimmung ( (Normbezeichnung))
- Dichte ρ und Trockendichte ρd
- Wassergehalt w
- Korndichte ρS , wenn abgeleitete Größen ermittelt werden sollen
- Durchmesser des Größtkorns …
|

|

Bei den Ersatzverfahren wird eine Probe aus der Oberfläche der zu prüfenden Schicht entnommen, verpackt und anschließend das zugehörige Volumen durch Ersatz gegen ein anderes Medium bekannter Dichte (z. B. Sand (Abschnitt 4.1.1.2.1.1), Wasser (Abschnitt 4.1.1.2.2.1), Flüssigkeit (Abschnitt 4.1.1.2.3.1) oder Gips (Abschnitt 4.1.1.2.4.1)) bestimmt. Baupraktisch nicht relevant ist das Schürfgruben-Verfahren. Die Ersatzverfahren unterscheiden sich …
|

|

|

|

Das Sandersatzverfahren kann zielführend in bindigen Böden und in ungleichkörnigen bzw. grobkörnigen nichtbindigen Böden, in denen ein Ausstechzylinder nicht ohne Beeinträchtigung des Bodengefüges eingebracht werden kann, angewendet werden (Fein- bis Mittelsande, Kies-Sand - Gemische). In Böden, deren Korngröße den Grobkiesbereich (63 mm) übersteigt oder die so große Porenräume aufweisen, dass der Prüfsand in diese eindringen kann, sollte das Sandersatzverfahren …
|
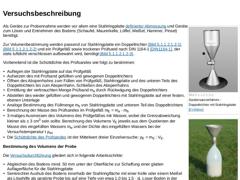
|

| (Bild: Sandersatzverfahren - Doppeltrichter mit Stahlringplatte [FI-Röhre]) | | (Bild: Doppeltrichter) | | (Bild: Sandersatzverfahren) |
Als Geräte zur Probennahme werden vor allem eine Stahlringplatte (Sandersatzverfahren nach DIN 18125-2) und Geräte zum Lösen und Entnehmen des Bodens (Schaufel, Maurerkelle, Löffel, Meißel, Hammer, Pinsel) benötigt.
Zur Volumenbestimmung werden passend zur Stahlringplatte ein Doppeltrichter (Bild 4.1.1.2.1.2) (Bild 4.1.1.2.1.2) |

|

|

|

Das Ballonverfahren ist für bindige Böden und für nichtbindige Böden geeignet, in denen sich standfeste Gruben ausheben lassen. Besonders geeignet ist es für feinkörnige Böden mit eingelagerten Kiesen und Steinen und für grobkörnige Böden (Fein- bis Mittelsande, Kies-Sand - Gemische, sandarmer Kies). Der Einsatz ist in Böden mit scharfkantigen Steinen jedoch nur eingeschränkt möglich, da die Ballonhaut beschädigt werden kann.
|

|

(Bild: Ballon-Verfahren - Densitometer [FI-Röhre])
Das Gerät zur Probennahme entspricht dem des Sandersatzverfahrens. Zur Volumenbestimmung wird ein sog. Ballongerät mit Stahlringplatte (Bild 4.1.1.2.2.2) verwendet.
Bestimmung des Volumens der Probe Die Versuchsdurchführung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: - Abgleichen der Auflagerfläche
- Planes, festes Auflegen der Stahlringplatte als "Stativ"
- Aushub des Bodens innerhalb der Stahlringfläche …
|

|

|

|

Das Flüssigkeitsersatzverfahren ist für bindige Böden, nichtbindige Böden und Mischböden geeignet, in denen sich standfeste Gruben ausheben lassen. Besonders geeignet ist es dabei für sehr durchlässige, grobkörnige Böden bzw. Fein- bis Grobsande, Kies-Sand - Gemische, sandarme Kiese.
|
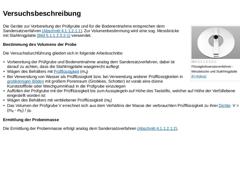
|

(Bild: Flüssigkeitsersatzverfahren - Messbrücke und Stahlringplatte [FI-Röhre]) Die Geräte zur Vorbereitung der Prüfgrube und für die Bodenentnahme entsprechen dem Sandersatzverfahren (Abschnitt 4.1.1.2.1.1). Zur Volumenbestimmung wird eine sog. Messbrücke mit Stahlringplatte (Bild 4.1.1.2.3.2) verwendet.
Bestimmung des Volumens der Probe Die Versuchsdurchführung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: - Vorbereitung der Prüfgrube und Bodenentnahme …
|

|

|

|

Das Gipsersatzverfahren ist für bindige Böden, nichtbindige Böden und Mischböden geeignet, in denen sich standfeste Gruben ausheben lassen. Besonders geeignet ist es dabei für grobkörnige Böden, in denen Prüfflüssigkeiten versickern würden, bspw. für Fein- bis Grobsande, Kies - Sand - Gemische, sandarme Kiese.
|

|

Die Geräte zur Vorbereitung der Prüfgrube und für die Bodenentnahme entsprechen dem Sandersatzverfahren. Zur Volumenbestimmung werden vor allem ein Tauchgefäß von rd. 10 l Fassungsvermögen mit Überlauf / Auffangvorrichtung sowie Stuckgips nach DIN 1168-1 [DIN1168-1] und DIN 1168-2 [DIN1168-2] benötigt.
Bestimmung des Volumens der Probe Die Versuchsdurchführung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: - Vorbereitung der Prüfgrube und Bodenentnahme analog …
|
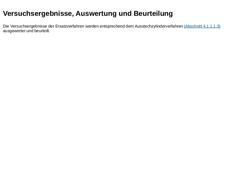
|

Die Versuchsergebnisse der Ersatzverfahren werden entsprechend dem Ausstechzylinderverfahren (Abschnitt 4.1.1.1.3) ausgewertet und beurteilt.
|

|

Der große Aufwand für Verdichtungsprüfungen über Ermittlung des Verdichtungsgrades mit direkten Methoden hat zur Entwicklung sog. indirekter Prüfverfahren geführt. Die indirekten Verfahren ermöglichen durch Korrelation zwischen physikalischen Messgrößen und bodenmechanischen Kenngrößen Rückschlüsse auf den Untergrund bzw. seine Eigenschaften. Über die mechanischen Bodenwiderstände kann basierend auf Erfahrungswerten auf den zugehörigen Verdichtungsgrad … |

|

|

|

Statische Plattendruckversuche sind vergleichsweise schnell (Versuchsdauer rd. 45 Minuten einschl. Auf- und Abbau) und einfach ausführbar. Sie sind daher auch für eine systematische Kontrolle der Verdichtung geeignet, wenn eine entsprechende Kalibrierung (Bodenarten, Vergleichswerte, z.B. für die Proctordichte) für das jeweilige Verfüllmaterial erfolgt ist. Insbesondere bei Verdichtungskontrollen im Nachgang zu Baumaßnahmen ist es daher empfehlenswert, … |

|

| (Bild: Einuhrplattendruckgerät - Prinzip des Wägebalkens [FI-Röhre]) | | (Bild: Plattendruckgerät in Transportkoffern [FI-Röhre]) |
Mit dem statischen Plattendruckversuch erfolgt eine Probebelastung der fertig verdichteten Fläche. Es werden Spannungs - Setzungslinien ermittelt, mit deren Hilfe die Verformbarkeit und Tragfähigkeit und damit die Verdichtung des Bodens beurteilt werden können.
Neben dem Plattendruckgerät werden versuchstechnisch Kraftmesseinrichtungen, … |
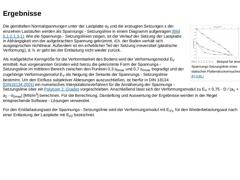
|

(Bild: Beispiel für eine Spannungs-Setzungslinie eines statischen Plattendruckversuches [FI-GBL]) Die gemittelten Normalspannungen unter der Lastplatte σ0 und die erzeugten Setzungen s der einzelnen Laststufen werden als Spannungs - Setzungslinie in einem Diagramm aufgetragen (Bild 4.1.2.1.3). Wie die Spannungs - Setzungslinien zeigen, ist der Verlauf der Setzung der Lastplatte in Abhängigkeit von der aufgebrachten Spannung gekrümmt, d.h. der Boden … |
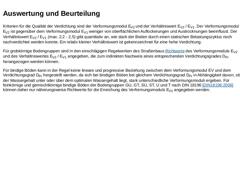
|

Kriterien für die Qualität der Verdichtung sind der Verformungsmodul EV2 und der Verhältniswert EV2 / EV1. Der Verformungsmodul EV2 ist gegenüber dem Verformungsmodul EV1 weniger von oberflächlichen Auflockerungen und Austrocknungen beeinflusst. Der Verhältniswert EV2 / EV1 (max. 2,2 - 2,5) gibt quantitativ an, wie stark der Boden durch einen statischen Belastungszyklus noch nachverdichtet werden konnte. Ein relativ kleiner Verhältniswert ist gekennzeichnet … |

|

|
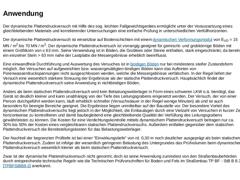
|

Der dynamische Plattendruckversuch mit Hilfe des sog. leichten Fallgewichtsgerätes ermöglicht unter der Voraussetzung eines gleichbleibenden Materials und korrelierender Untersuchungen eine einfache Prüfung in unterschiedlichen Verfüllhorizonten.
Der dynamische Plattendruckversuch ist einsetzbar auf Bodenschichten mit einem (Dynamischer Verformungsmodul) von EVD = 15 MN / m2 bis 70 MN / m2. Der dynamische Plattendruckversuch ist vorrangig geeignet … |